Dass ein offen atheistischer Intellektueller wie Juan José Millás in El País eine Kolumne schreibt, in der er, wenn auch ironisch, die ontologische Größe des eucharistischen Wunders anerkennt, sollte im katholischen Milieu mehr als ein verlegenes Lächeln auslösen. Es sollte uns dazu zwingen, innezuhalten und uns zu fragen, was schiefläuft, wenn sogar ein externer Beobachter eine tiefe Dissonanz zwischen dem, was die Kirche zu glauben behauptet, und der Art und Weise erkennt, wie dieses Mysterium in der Praxis gelebt – oder trivialisiert – wird.
Millás schreibt nicht als Gläubiger und will es auch nicht sein. Genau deswegen ist seine Diagnose so aufschlussreich. Er geht von einer korrekten doktrinären Prämisse aus: Die Kirche lehrt, dass bei der Konsekration eine reale, wörtliche, substantielle Veränderung stattfindet. Nicht symbolisch. Nicht metaphorisch. Ein Wunder ersten Ranges. Und dennoch stellt er fest, was jeder überprüfen kann: Die übliche Szene in vielen liturgischen Feiern spiegelt in keiner Weise die Transzendenz wider, die dort geschieht. Müde Gesten, allgemeine Zerstreuung, Routine. Als ob nichts Außergewöhnliches vor sich ginge.
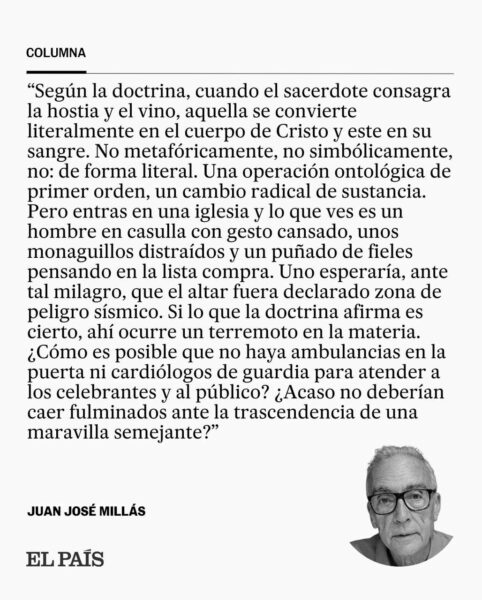
Die Frage, die er stellt – mit Sarkasmus, aber logisch – ist vernichtend: Wenn wir wirklich glauben, was wir zu glauben behaupten, warum handeln wir dann nicht entsprechend? Warum gibt es kein Zittern, kein Staunen, keine ehrfürchtige Furcht? Warum wirkt der Altar nicht wie eine heilige Zone, abgetrennt, bewacht?
Hier wird die externe Beobachtung zu einer inneren Anklage. Es ist nicht der Atheist, der das Mysterium banalisiert. Wir sind es. Oder zumindest eine Art, die Liturgie zu leben, die den Sinn des Heiligen schrittweise erodiert hat, bis er fast unsichtbar geworden ist.
Es geht nicht darum, Theatralik oder religiöse Hysterie zu fordern. Es geht um Kohärenz. Die Kirche wusste immer, dass das Mysterium Schutz erfordert. Über Jahrhunderte hinweg, sowohl im Osten als auch im Westen, wurden konkrete Formen entwickelt, um das Heilige zu schützen: Trennung des Presbyteriums, präzise Gesten, Schweigen, Schleier, Zeichen der Distanz. Nicht aus Verachtung des Volkes, sondern aus Bewusstsein des Mysteriums.
Im Westen schwächte sich dieses Bewusstsein ab. Und was verloren ging, war nicht Nähe, sondern Staunen. Nicht Teilnahme, sondern Reverenz. Wenn alles gezeigt wird, wird alles banalisiert. Wenn nichts geschützt wird, wird nichts verehrt.
Deshalb ist es bedeutsam – und besorgniserregend –, dass ein Nichtgläubiger die Inkohärenz aufzeigt, weil er eine offensichtliche Kluft wahrnimmt: eine Kirche, die das größte Wunder verkündet und es feiert, als wäre es ein Formalakt.
Das Problem ist nicht, dass die Welt nicht an die Eucharistie glaubt. Das Problem ist, dass es oft so scheint, als ob die Kirche selbst nicht wirklich an das glaubt, was sie bewahrt. Und wenn das Mysterium aufhört, die Liturgie zu strukturieren, verdünnt es schließlich auch den Glauben.
Vielleicht ist dies eine jener Gelegenheiten, in denen es ratsam ist, sogar auf den zu hören, der von außen spricht. Um anzuerkennen, dass die Risse so sichtbar sind, dass sie nicht mehr unbemerkt bleiben. Wenn sogar Atheisten die Widersprüchlichkeit wahrnehmen, ist das ein Zeichen, dass etwas Wesentliches korrigiert werden muss.
Die abschließende Frage ist nicht rhetorisch: Wollen wir weiterhin das Mysterium erklären oder uns wieder davor knien? Denn der Glaube hält sich nicht nur mit richtigen Worten aufrecht, sondern mit Gesten, die sie glaubwürdig machen.
